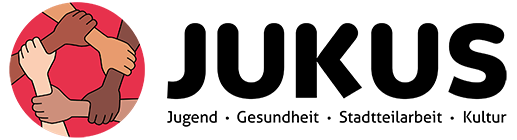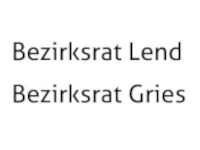Inhalt
– Notwendige Behandlung – Risiko Abhängigkeitserkrankung
– Daten & Fakten
– Trends
– Jugendliche
– Anzeichen für riskanten Medikamentengebrauch/abhängigkeit
– Medikamentengebrauch – “richtig (&) gut beraten”
◦ Selbstcheck Medikamentengebrauch
◦ Fragen zu Risiken und Nebenwirkungen
◦ Diagnose und Behandlung von Medikamentenabhängigkeit
– Hilfreiche Informationsmaterialien
– Vertiefende Information rund um Medikamenten mit Abhängigkeitspotenzial
Akute telefonische Hilfe
Bei akuten Krisen als erste Anlauf- und Ansprechstelle:
PsyNot – das psychiatrische Krisentelefon für die Steiermark: 24 Stunden täglich erreichbar, kostenfrei und 100 % anonym
Telefonnummer : 0800 44 99 33
Weitere JUKUS Angebote zu Sensibilisierung zu Medikamentengebrauch
• Professionist*innen, Multiplikator*innen
Schulungen zur Anwendung der Präventionsmethode: – »FÜR ALLE(S) WAS DABEI?! Riskanter Medikamentenkonsum im Alltag
Team Fortbildungen/Workshops zur allgemeinen Auseinandersetzung mit dem Thema: Gesundheitskompetenter Medikamentengebrauch
• Jugendliche
Workshops für Jugendliche (in Schule, offene Jugendarbeit, Freizeit, etc.)
Nach der Methode – »FÜR ALLE(S) WAS DABEI?! Riskanter Medikamentenkonsum im Alltag –
• Interessierte/Patient*innen/Kund*innen
Workshop/Vortrag: Gesundheitskompetenz, Gesundheitsinformationen und Medikamentengebrauch
Erfolgt in Abstimmung auf die jeweilige Zielgruppe
Notwendige Behandlung – Risiko Abhängigkeitserkrankung
Medikamente sind wichtige Instrumente bei der Heilung von Erkrankungen und der Linderung von Beschwerden. Ein bewusster und verantwortungsvoller Umgang mit Medikamenten ist dabei wichtig, um gesund zu werden und zu bleiben. Allerdings kann die Anwendung von Medikamenten auch Risiken bergen.
Es gibt Medikamente, die neben unerwünschte Nebenwirkungen auch ein eigenes Schadens- und Abhängigkeitspotenzial besitzen.
Daten & Fakten
Bei der Einnahme mancher Medikamente kann als Nebenwirkung eine körperliche Abhängigkeitssymptomatik entstehen. Viele abhängig machende Medikamente werden von Allgemeinmediziner*innen verschrieben. Besonders hoch ist das Risiko, wenn Patient*innen Medikamente lange oder in zu hoher Dosis einnehmen.
Zu den Medikamenten mit hohem Abhängigkeitspotential zählen Schmerz-, Schlaf- und Beruhigungsmittel (Benzodiazepine/Benzos), aber auch Aufputschmittel (Ritalin und Co), Hustensäfte (mit Codein), Abführmittel1 oder und Nasensprays mit abschwellender Wirkung.
Für Österreich gibt es aktuell keine konkreten Daten zur Verbreitung von Medikamentenabhängigkeit, daher braucht es eine Orientierung an den Daten aus Deutschland. In Deutschland geht man davon aus, dass etwa 3,2 % der Bevölkerung von verschriebenen Medikamenten abhängig sind.
Übertragen auf Österreich entspricht das etwa 291.000 betroffenen Menschen. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher sein. Damit ist Medikamentenabhängigkeit nach Nikotin und Alkohol die dritthäufigste Abhängigkeitserkrankung in Österreich.
Trends
Waren bislang ein Großteil der betroffenen Menschen ältere Frauen, die von Schlaf- und Beruhigungsmitteln abhängig waren, so zeichnen sich in den letzten Jahren hinsichtlich der Konsument*innen sowie deren Konsummotivation aber auch neue Entwicklungen ab.
Phänomen „Gehirndopings“/medikamentösen Neuro-Enhancement: Trend zur Selbstoptimierung durch Hirndoping, auch mittels verschreibungspflichtiger Medikamenten nimmt weiter zu. Auch verschreibungspflichtige Neuro-Enhancer werden eher von ganz jungen oder aber älteren Menschen eingenommen.2
Studierende: Rund 14 % der Befragten gaben an, während ihres Studiums schon einmal legale (8 %) oder illegale (6 %) Substanzen zur Leistungssteigerung und/oder Stresskompensation eingenommen zu haben.3
Jugendliche
Jugendliche und junge Erwachsene haben eine Vielzahl von Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, dies geht häufig mit einer Phase des Ausprobierens einher.
Rund zehn Prozent der 14-17-jährigen Schüler*innen haben bereits auf ärztliche Verordnung hin verschreibungspflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmittel eingenommen.4
Etwa 6,5 % der Jugendlichen zw. 18 und 20 Jahren weisen einen problematischen Medikamentenkonsum5 auf.
Konsummotive von Jugendlichen:
• Medizinische Indikation /Selbstmedikation bei geringen Symptomen
• Neugierde: Suche nach Erfahrung und neuen Empfindungen
• Konsum im Partyumfeld: oft in Mischkonsum Alkohol, Ziel ist high zu werden
• Leistungssteigerung: Arbeit, Sport, Schule, Sexualität
• Aussehen zu kontrollieren: Abführmittel, Anabolika
• Zugehörigkeitsgefühl: durch Social Media, Influencer*innen – TRENDS
◦ Rap Szene: z. B. Capital Bra: Tilidin – 16 Songs, T-Low,
◦ Lucio 101, Superkraft ,,Mische Fanta mit Hustensaft entwickle dadurch eine Superkraft”
• Zukunftsängste/Perspektivenlosigkeit/Überforderung: “unendlich viele Möglichkeiten, die dann doch nicht da sind”
Anzeichen für riskanten Medikamentengebrauch/Medikamentenabhängigkeit
• Einnahmen sind weder krankheits- noch situationsbezogen
• Konsum erfolgt, um ein bestimmtes Gefühl zu erreichen oder zu verdrängen
• Einnahme erfolgt vorsorglich, bevor Beschwerden auftreten
• Konsum wird verheimlicht oder verharmlost – Sorge, dass die Ärzt*innen kein Rezept mehr ausstellen
• häufiger Wechsel von Ärzt*innen um Medikamente (weiter) verschrieben zu bekommen
• Aufsuchen unterschiedlicher Apotheken, um Rezepte einzulösen oder rezeptfreie Medikamente zu kaufen
• Wirkung lässt bei gleichbleibender Dosis nach, Dosis wird erhöht, um gewünschte Wirkung zu erzielen
• Beim Absetzen des Medikaments kommt es zu: Schwitzen, Zittern, innere Unruhe, Angstzustände, depressive Verstimmungen, Halluzinationen, etc.)
Medikamentengebrauch – “richtig (&) gut beraten”
Haben Sie keine Scheu davor, sich Unterstützung von Fachpersonen zu holen. Dies ist in der Regel kostenlos, anonym und vertraulich und nicht nur für Betroffenen, sondern auch deren Angehörige und Bezugspersonen möglich.
Sie möchten eine Einschätzung zum eigenen Medikamentenkonsum oder den einer Ihnen nahestehenden Person?
Selbstcheck Medikamentengebrauch6
Wollen Sie eine Einschätzung zu ihrem Medikamentengebrauch, so kann diese über einen Selbsttest erfolgen. Ein Selbsttest dient einer ersten Einordnung, er ist kein Diagnose-Instrument und ersetzt eine Diagnostizierung durch Mediziner*innen nicht!
Eine Möglichkeit für einen Medikamentenselbsttest ist von “Die Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich”, welchen Sie beim angeführten QR-Code finden.

Fragen zu Risiken und Nebenwirkungen
• Arzt oder Ärztin sind die zentralen Ansprechpartner*innen, wenn es um Medikamentengebrauch geht.
Unter Umständen ist es sinnvoll, eine zweite Meinung zu Medikationen im Kontext mit ihrer individuellen Krankengeschichte einzuholen
• Apotheker*in berät Sie gerne persönlich zu Ihrem Medikamentengebrauch, zu Wechselwirkungen und Nebenwirkungen
◦ Hierfür gibt es in Ihrer Apotheke einen Bereich für ein vertrauliches 4-Augen Gespräch. (aktuell kostenpflichtig)
• Psychosoziale Beratung Steiermark
◦ Online Beratung: https://gesundheitsfonds-steiermark.at/plattform-psyche/ambulante-sozialpsychiatrische-versorgung/#onlineberatung
• Suchtberatungsstellen
https://gesundheitsfonds-steiermark.at/suchthilfe/suchthilfeeinrichtungen
◦ Online Beratung zu Suchtfragen
https://onlineberatung.bas.at/apps/onlineberatung#
Diagnose und Behandlung von Medikamentenabhängigkeit
Medikamentenabhängigkeit wird in Österreich ausschließlich von Mediziner*innen diagnostiziert. Gemeinsam beraten Betroffene und behandelnden Ärzt*innen über mögliche Behandlungsoptionen und entscheiden über das weitere Vorgehen.
Mögliche Optionen stellen dabei Stabilisierung und/oder Reduktion der Dosis, aber auch Entzug des Medikamentes dar.
Da die Symptome eines Medikamentenentzugs unvorhersehbar sein können, solle das Absetzen des Medikaments unter Begleitung von Ärzt*innen stattfinden. Bei der Entzugsbehandlung wird die Dosis des Medikaments so lange verringert, bis die Dosis bei null ist. Körperliche Stabilisierung, Diagnose und Behandlung möglicher Begleit- und Folgeerkrankungen, sowie die Behandlung eventuell auftretender Entzugserscheinungen im Vordergrund.7
Diese Einrichtungen (PDF, 0,1 MB) bieten Hilfe rund um das Thema Medikamentengebrauch und –abhängigkeit an. Diese Angebote richten sich auch an Angehörige.
Hilfreiche Informationsmaterialien
Hier finden Sie Infomaterialien der Fachstelle zum Download:
Infoblatt Medikamentengebrauch und Abhängigkeit
Als Druckvariante bestellen unter: E: gesundheit@jukus.at.
Verfügbare Sprachen: Deutsch, Deutsch – Leichter Lesen, Arabisch, BKS, Englisch, Farsi, Ukrainisch, Türkisch, Russisch, Rumänisch
Handlungskonzept Medikamentengebrauch und –abhängigkeit (PDF, 0,7 MB)
Ermöglicht einen Überblick über Medikamentengebrauch, schädlichen Gebrauch von Medikamenten und Medikamentenabhängigkeit. Das Ziel ist zu informieren, auf das Thema aufmerksam zu machen, sowie Möglichkeiten selbst aktiv zu werden aufzuzeigen.
Das „Handlungskonzept Medikamentengebrauch und –abhängigkeit“ richtet sich an alle Interessierten, die sich näher mit Medikamentengebrauch und –abhängigkeit auseinandersetzen wollen. Für Professionist*innen, die in ihrer Arbeit mit dem Thema in Berührung kommen, kann es als Tool zum nicht stigmatisierenden Umgang mit (potenziell) Betroffenen sein.
Informationen und Materialien unserer Partner*innen finden Sie zudem hier:
• Fachstelle Suchtprävention Berlin – Infoblatt Medikamente
• Fachstelle Suchtprävention Berlin – Infokarte Medikamente
• Fachstelle Suchtprävention Berlin – Infokarte Opioide … und was das mit Heroin zu tun hat
• Fachstelle Suchtprävention Berlin – Infokarte Benzos (Xanax, Tavor, Valium,…) und schnell nicht mehr ohne
• Fachstelle Suchtprävention Berlin – Infokarte Leistung um jeden Preis? – Schmerzmittel im Sport
• Vivid – It´s Up 2U Suchtinfo: Medikamente
• DHS – Basisinfo Medikamente
• DHS – Medikamentenabhängigkeit
• DHS – Unabhängig im Alter, Medikamente – sicher und sinnvoll gebrauchen
• Infodrog – Faktenblatt Medikamente und Mischkonsum
• Priscus-Liste 2.0 – potenziell inadäquate Medikation für ältere Menschen
• SHK – Flyer Berlin
• SPZ – Factsheet Medikamente als Drogen
• Sucht / Drogen – Rat und Hilfe 2020
• Sucht Schweiz – Flyer Medikamente
• Sucht Schweiz – Medikamente, mit Jugendlichen darüber sprechen – ein Leitfaden für Eltern
Ohne Aufklärung kein Problembewusstsein
Die Tatsache, dass Medikamente zu Heilzwecken verordnet und eingenommen werden, wirkt als Barriere für die Entwicklung des Problembewusstseins bei möglichen Abhängigkeitserkrankungen.
Daher bedarf es umfassenden Sensibilisierungs- und Präventionsmaßnahmen in der Allgemeinbevölkerung, aber auch von Multiplikator*innen und Schlüsselprofessionen beim Zu- und Umgang mit Medikamenten.
Weitere Angebote zu Sensibilisierung zu Medikamentengebrauch in der Steiermark:
Workshopangebot für unterschiedliche Zielgruppen:
• Professionist*innen, Multiplikator*innen
• Interessierte
• Jugendliche
• Schulen
Vertiefende Information rund um Medikamenten mit Abhängigkeitspotenzial
Zu den Medikamentengruppen mit hohem Abhängigkeitspotenzial zählen insbesondere Beruhigungs- und Schlafmedikamente, Schmerzmittel, Weck- und Aufputschmittel8, Abführmittel9 und Anabolika.
Schlaf- und Beruhigungsmittel
Als Schlaf- und Beruhigungsmittel kommen vorrangig Benzodiazepine und sogenannte Z-Substanzen zum Einsatz, u. a. bei Schlafstörungen, Angsterkrankungen, Erregungszuständen, Muskelspasmen.
Wirkung: angstlösend, beruhigend, muskelentspannend, und amnestisch (Verlust der Erinnerung).
Hohe Wirksamkeit steht dabei geringen akuten Nebenwirkungen gegenüber.
Hohes Abhängigkeitspotential: nicht länger als 14 Tage, regelmäßige dauerhafte Einnahme wird NICHT empfohlen.10
Bei abruptem Absetzen des Medikaments – Entzugssymptome:
Schlafstörungen oder Unruhezuständen, entsprechen häufig den Ausgangsbeschwerden, sodass die Medikamenten-Einnahme wieder aufgenommen wird.
Dauer- oder Übergebrauch von Benzodiazepinen kann zudem zu folgenden unerwünschten Wirkungen führen:
• Verringerung der Merk- und Gedächtnisfähigkeit, demenzartigen Symptome
• Koordinationsstörungen: erhöhtes Sturz- und Unfallrisiko aufgrund von Muskelschwächen
• Gefühlsverflachung: Emotionen und Gefühle werden abgestumpft wahrgenommen.11
Für Benzodiazepin-Langzeitkonsum sind Folgeschäden wie anhaltende kognitive und amnestische12 Defizite bekannt.13
Schmerzmittel
Etwa 50 % der Hausarztkontakte sind durch chronische Schmerzen geprägt. Verordnet werden Schmerzmittel v.a. von Allgemeinmediziner*innen. Starke Schmerzmittel (dazu zählen Opiate und Opioide) können nur mit speziellem Betäubungsmittelrezept abgegeben werden.
Die regelmäßige und/oder eine unbedachte Verordnung und Einnahme von Schmerzmitteln, insbesondere bei ungeklärten Schmerzzuständen, kann jedoch auch eine Abhängigkeitserkrankung erzeugen.
Der Gebrauch von Mischanalgetika (Paracetamol, in Mischpräparaten) ist in der Bevölkerung weithin verbreitet, zumal einige von ihnen frei verkäuflich sind.
Mögliche Nebenwirkungen, je nach Substanz: Sedierung oder psychischer Stimulation, das Risiko psychischer Gewöhnung.
Ist nach länger andauerndem Gebrauch eine körperliche Gewöhnung eingetreten, treten bei Ausbleiben der Medikation vegetative Symptomen, wie Entzugskopfschmerzen auf.14
Weck und Aufputschmittel: Psychostimulanzien
Sind antriebssteigernde Substanzen, die kurzzeitige Konzentration und Leistung erhöhen.
Psychostimulanzien enthalten Wirkstoffe aus der Amphetamingruppe (Fenetyllin, Amfetaminil, viele sind als illegale Drogen wie Speed oder Ectasy bekannt) bzw. Amphetaminderivate (Pemolin, Methylphenidat).
Die Medikamentengruppe wird zur Behandlung von ADHS eingesetzt.
Mittleres bis hohes Abhängigkeitspotential
Wirkung: Linderung von Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität.
Unterdrückung von Müdigkeit und des Hungergefühls, sowie der Steigerung der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit.
Begleiterscheinungen/Nebenwirkungen: Herzrasen oder erhöhter Blutdruck sein. Nebenwirkungen bei schädlichem Gebrauch: psychische Abhängigkeitsentwicklung sowie psychotische Reaktionen sein.
Anabolika
Anabolika gehören zur Gruppe der form- und leistungsfördernden Substanzen, die häufig zur Verbesserung von Aussehen und Leistung im Fitnessbereich eingesetzt werden.
Beinhalten viele unterschiedliche Substanzen, dazu gehört auch Testosteron.
Der Konsum erfolgt, häufig auf Basis von Erfahrungen/Anekdoten anderer, es gibt kaum wissenschaftlich-medizinische Auseinandersetzung damit.
Weit verbreitet; ca. 30 % der Fitnessstudio-Kund*innen, 35 % unter 21 Jahren kommen mit Anabolika in Kontakt/konsumieren diese, zumindest zeitweise.
Das Suchtpotential wird als hoch eingeschätzt – bis zu 30 % der Konsument:innen entwickeln eine Abhängigkeit.
Anabolika-Sprechstunde des Arud Zentrum für Suchtmedizin in der Schweiz ist ein spezialisiertes Angebot für Anabolika-Konsument:innen.
Relaxantien, Appetitzügler
Da die meisten Abführmittel rezeptfrei in Apotheken erhältlich sind, werden sie häufig ohne ärztlichen Rat eingenommen. Dadurch kommt es leicht zu einer falschen Anwendung oder sogar einem Missbrauch (Laxanzienabusus).
Die regelmäßige Einnahme von Abführmitteln führt zu einer Gewöhnung des Körpers, sie sollten daher nicht länger als 2 Wochen ohne ärztliche Abklärung eingenommen werden. Der Darm kann dann ohne die Unterstützung der Substanzen nicht mehr richtig arbeiten.
Wird das Medikament von einem Tag auf den anderen abgesetzt, ist die Darmentleerung möglicherweise zunächst erschwert.
Ozempic & co: Abnehmspritze
Wirkstoff: Semaglutid
Zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 und Adipositas entwickelt.
Wird auch zur Gewichtsreduktion eingesetzt.
Wirkung: Bei der Aufnahme von Nahrung wird vermehrt Insulin hergestellt und in der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird. Zudem verzögert Semaglutid die Magenentleerung. Führt zu einer Erhöhung des Sättigungsgefühls und zu einer Reduktion des Appetits.
Auch bei verordneter Anwendung muss die Dosierung langsam gesteigert werden und Nebenwirkungen gering zu halten.
Nebenwirkungen: Magen-Darm-Beschwerden, wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Verstopfung
Achtung, es besteht die Gefahr einer Unterzuckerung!
Symptome dafür sind: Kalter Schweiß, kühle, blasse Haut, Kopfschmerzen, schneller Herzschlag, Übelkeit oder starkes Hungergefühl, Sehstörungen, Müdigkeit oder Schwäche, Nervosität, Ängstlichkeit, Zittern, Verwirrung oder Konzentrationsschwierigkeiten
Sofort mit Traubenzucker oder noch besser ein zuckerhaltiges Getränk gegensteuern!
Potentiell abhängig machende, rezeptfreie Medikamente15
Apothekenpflichtige, frei in Apotheken verkäufliche Medikamente, sogenannte “Over the counter”-Arzneimittel, werden insbesondere zur Selbstmedikation angewandt. Sie stellen einen fixen Bestandteil der Krankheitsversorgung und Behandlung dar. Einige von ihnen können jedoch auch Abhängigkeiten auslösen. Dazu zählen insbesondere:
• Nasensprays, Nasentropfen mit abschwellender Wirkung
• Abführmittel
• Entwässerungsmittel
• Schmerzmittel (rezeptfreie, apothekenpflichtige)16
Bei einem Dauergebrauch von Schmerzmitteln wird das Risiko von Schmerzmittel-assoziierten Kopfschmerzen erhöht. Besonders Mischpräparate mit Koffein weisen dabei ein hohes Risiko für einen schädlichen Gebrauch auf. Sie reduzieren Schmerzen, wirken aktivierend und leistungssteigernd.17
Fußnoten
(1) https://www.aok.de/pk/magazin/koerper-psyche/verdauungssystem/abfuehrmittel-nebenwirkungen-und-gefahr-eines-laxanzienabusus/#
(2) Sattler et al. (2024): Prevalence of Legal, Prescription, and Illegal DrugsAiming at Cognitive Enhancement across Sociodemographic Groups in Germany, Deviant, Behavior, DOI: 10.1080/01639625.2024.2334274
(3) HISBUS-Studie (2015)
(4) ESPAD Österreich (2019): Forschungsbericht.Gesundheit Österreich, Wien
(5) Epidemiologischem Suchtsurvey: 2021, https://www.esa-survey.de/
(6) Watzl et al. (1991)KFM-Kurzfragebogen für Medikamentengebrauch
(7) https://www.api.or.at/sucht-abhaengigkeit/medikamentensucht/
(8) DGPPN; DG-Sucht (2020): S3-Leitlinie Medikamentenbezogene Störungen. Langfassung. Hg. v. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF)
(9) https://www.aok.de/pk/magazin/koerper-psyche/verdauungssystem/abfuehrmittel-nebenwirkungen-und-gefahr-eines-laxanzienabusus/
(10) Riemann et al. (2017): S3-Leitlinie Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen. URL: https://www.dgsm.de/fileadmin/dgsm/leitlinien/s3/S3_LL_Nicht-erholsamer_Schlaf_Kap_Insomnie_Somnologie_2017.pdf
(11) Bundesärztekammer: Medikamente – schädlicher Gebrauch und Abhängigkeit (o.J). URL: https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/LeitfadenMedAbhaengigkeit.pdf
(12) amnestisches Defizit: Gedächtnisstörung, die auf das autobiographische Gedächtnis begrenzt ist
(13) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Hrsg) (2015): Medikamentenabhängigkeit. Suchtmedizinische Reihe Band 5
(14) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Hrsg) (2015): Medikamentenabhängigkeit. Suchtmedizinische Reihe Band 5
(15) Bundesärztekammer: Medikamente – schädlicher Gebrauch und Abhängigkeit (o.J).
(16) Bundesärztekammer: Medikamente – schädlicher Gebrauch und Abhängigkeit (o.J).
(17) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Hrsg) (2015): Medikamentenabhängigkeit. Suchtmedizinische Reihe Band 5